



Next: Tabellenverzeichnis
Up: Massenbestimmung an einer
Previous: Literatur
- Aufgetragen in nicht normierten Einheiten ist der Röntgenfluß\
(Abschnitt ) eines
heißen thermischen Plasmas als Funktion von
 , wobei
, wobei
 und A= solare Metallizität. Die 4 Kurven
zeigen den am Detektor
registrierten Fluß für die Werte der Wasserstoffsäulendichte
und A= solare Metallizität. Die 4 Kurven
zeigen den am Detektor
registrierten Fluß für die Werte der Wasserstoffsäulendichte
 . Die
Emissivität und der registrierte Fluß sind nahezu konstant im
Temperaturbereich
. Die
Emissivität und der registrierte Fluß sind nahezu konstant im
Temperaturbereich  . Entnommen aus
[BöHRINGER 1995a, Fig. 1,].
. Entnommen aus
[BöHRINGER 1995a, Fig. 1,].
- Aitoff-Projektion der
Galaxienhaufenverteilung. Angegeben sind galaktische Koordinaten. Die gefüllten
Quadrate repräsentieren Galaxienhaufen mit
 . Alle
gezeigten Haufen sind durch einen Röntgenfluß über dem Fluß
limit von
. Alle
gezeigten Haufen sind durch einen Röntgenfluß über dem Fluß
limit von  gekennzeichnet.
gekennzeichnet.
- Rotverschiebungsdiagramm eines Ausschnitts
der Galaxienhaufenverteilung. Für alle
gezeigten Haufen gilt
 und
und  . Das Milchstraß
enband zieht sich teilweise durch die
Rektaszension
. Das Milchstraß
enband zieht sich teilweise durch die
Rektaszension 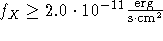 .
.
- Effektive Fläche von Teleskopaufbau kombiniert mit
PSPC. Die durchgezogene Linie gilt für on-axis-Quellen und die
gestrichelte Linie für Quellen mit einem off-axis-Winkel von 30
Bogenminuten (EXSAS-Kalibrationsdateien). Das
Minimum bei
 ist durch das Material des
Eintrittsfensters des PSPCs bedingt (Absorptionskante von Kohlenstoff).
ist durch das Material des
Eintrittsfensters des PSPCs bedingt (Absorptionskante von Kohlenstoff).
- on-axis-Punktbildfunktion von Teleskopaufbau kombiniert mit
PSPC. Die durchgezogene Linie gilt für Photonenenergien von
 , die gestrichelte Linie für
, die gestrichelte Linie für  und die
punktgestrichelte Linie
für
und die
punktgestrichelte Linie
für  (EXSAS-Kalibrationsdateien).
(EXSAS-Kalibrationsdateien).
- Rohbild von Abell 3526 (Centaurus Haufen). Die Kantenlänge
beträgt acht Grad. Der Kreis deutet das Gesichtsfeld des PSPCs an. Es
ist mit bloßem Auge erkennbar, daß die Emission des Haufens
über das PSPC-Gesichtsfeld hinausgeht. Neben
der ausgedehnten Emission des Galaxienhaufens sind noch Punktquellen
und Photonen des Hintergrunds zu sehen.
- Konturbild des Galaxienhaufens MKW 4, belichtungs- und
vignettingkorrigiert. Das Bild wurde mit einer variablen Gauß
-Funktion gefaltet, deren Standardabweichung
 zum Zentrum hin abnimmt.
Dadurch bleiben Strukturen auf unterschiedlichen Längenskalen besser
sichtbar.
zum Zentrum hin abnimmt.
Dadurch bleiben Strukturen auf unterschiedlichen Längenskalen besser
sichtbar.
- Dem Rohbild des Galaxienhaufens MKW 4 überlagert sieht man
hier den Ring, in dem die Flächenhelligkeit des Hintergrunds
bestimmt wird. Segmente, in denen
ein Kreuz zu sehen ist, werden verworfen
(Abschnitt ). Aus den anderen wird der Mittelwert
gebildet. Der Radius des Gesichtsfeldes der pointierten Beobachtung
beträgt ein Grad.
- Integrierte Zählrate des Galaxienhaufens
Abell 2029 (durchgezogene Linie). Die einhüllenden gestrichelten
Linien stellen den Poissonfehler dar. Die Bedeutung der horizontal und
vertikal verlaufenden gestrichelten Linien wird im Text erklärt
(Abschnitt ).
- Bestimmung der integrierten Zählrate des Galaxienhaufens
EXO 0422 unter Benutzung der gemessenen Flächenhelligkeit des
Hintergrunds. Dieser Haufen wurde ausgewählt, um die Wirkung der
Hintergrundskorrektur zu veranschaulichen. Bei den meisten anderen
Haufen ist der Effekt kleiner. Man erkennt auch die geringere
Belichtungszeit dieses
RASS-Bildes an den größeren Poissonfehlern im Vergleich zu der
pointierten Beobachtung von Abell 2029 (Abb. ).
- Bestimmung der integrierten Zählrate des Galaxienhaufens
EXO 0422 unter Benutzung der korrigierten Flächenhelligkeit des
Hintergrunds (Beschreibung siehe Abschnitt ). Die
korrigierte Zählrate
weicht jedoch nur um
 von der unkorrigierten ab. Diese Abweichung liegt innerhalb des
statistischen Fehlers.
von der unkorrigierten ab. Diese Abweichung liegt innerhalb des
statistischen Fehlers.
- Auf der Abszisse sind die Zählraten, bestimmt mit den
gemessenen Werten für den Hintergrund, aufgetragen. Für die
Zählraten auf der Ordinate wurden die korrigierten Hintergrundswerte
verwendet. Auf Fehlerbalken wurde zugunsten der Übersichtlichkeit
verzichtet. Die Haufen Perseus und Coma wurden wegen ihrer hohen
Zählraten in diesem Diagramm nicht mit eingezeichnet. Die
Abweichungen der Zählraten dieser beiden Haufen sind ebenfalls nur
minimal. Bei der einzigen starken Abweichung der Zählraten bei dem
Haufen S 636 (
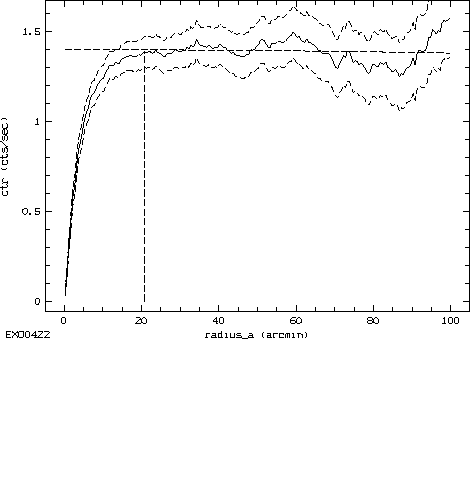 ) scheint die
Ursache eine Kombination von variierendem
Hintergrund und einigen diskreten Quellen in nicht verworfenen
Segmentflächen zu sein.
) scheint die
Ursache eine Kombination von variierendem
Hintergrund und einigen diskreten Quellen in nicht verworfenen
Segmentflächen zu sein.
- Flächenhelligkeitsprofil von Abell 2063 mit
 -Modell-Fit. Die Flächenhelligkeit ist in Einheiten von
-Modell-Fit. Die Flächenhelligkeit ist in Einheiten von  angegeben und der Radius
in
angegeben und der Radius
in 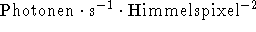 . Die Ringbreite ist angedeutet durch die
horizontalen Balken an den Meßpunkten.
. Die Ringbreite ist angedeutet durch die
horizontalen Balken an den Meßpunkten.
- Flächenhelligkeitsprofil von Abell 2063 mit
Doppel-
 -Modell-Fit. Die durchgezogene Linie repräsentiert den
Fit
an die von der Punktbildfunktion entfalteten Datenpunkte. Die
gestrichelte Linie ergibt sich, wenn der Fit wieder mit der PBF
gefaltet wird. Diese gestrichelte Linie kann mit den
abgebildeten, tatsächlich registrierten Werten verglichen
werden. Da die hier untersuchten nahen Haufen sehr ausgedehnt erscheinen, ist der Einfluß\
der PBF jedoch vernachlässigbar.
-Modell-Fit. Die durchgezogene Linie repräsentiert den
Fit
an die von der Punktbildfunktion entfalteten Datenpunkte. Die
gestrichelte Linie ergibt sich, wenn der Fit wieder mit der PBF
gefaltet wird. Diese gestrichelte Linie kann mit den
abgebildeten, tatsächlich registrierten Werten verglichen
werden. Da die hier untersuchten nahen Haufen sehr ausgedehnt erscheinen, ist der Einfluß\
der PBF jedoch vernachlässigbar.
- Gasdichteprofil des Galaxienhaufens Abell 2063. Die
durchgezogene Linie stellt das mit dem einfachen
 -Modell
berechnete
und die gestrichelte Linie das mit dem Doppel-
-Modell
berechnete
und die gestrichelte Linie das mit dem Doppel-  -Modell berechnete
Profil dar. Man sieht, daß das Doppel-
-Modell berechnete
Profil dar. Man sieht, daß das Doppel-  -Modell die erhöhte
zentrale Flächenhelligkeit, als erhöhte zentrale Dichte
interpretiert, besser wiedergibt. In den weiter außen liegenden
Bereichen sind die Unterschiede jedoch gering.
-Modell die erhöhte
zentrale Flächenhelligkeit, als erhöhte zentrale Dichte
interpretiert, besser wiedergibt. In den weiter außen liegenden
Bereichen sind die Unterschiede jedoch gering.
- Integrierte Gasmasse des Galaxienhaufens Abell 2063 in
Abhängigkeit des Radius'. Die
durchgezogene Linie stellt die mit dem einfachen
 -Modell
berechnete und die gestrichelte Linie die mit dem
Doppel-
-Modell
berechnete und die gestrichelte Linie die mit dem
Doppel-  -Modell berechnete Gasmasse dar.
-Modell berechnete Gasmasse dar.
- Zentrale Elektronenzahldichten der 53 Galaxienhaufen aus Tab. ,
bestimmt mit dem einfachen
 -Modell (Abszisse) und dem
Doppel-
-Modell (Abszisse) und dem
Doppel-  -Modell (Ordinate). Die Dichten liegen im Bereich
-Modell (Ordinate). Die Dichten liegen im Bereich
 Teilchen pro
Teilchen pro  . Man erkennt die beim
Doppel-
. Man erkennt die beim
Doppel-  -Modell häufig höher bestimmte zentrale Dichte,
entsprechend dem zentralen Flächenhelligkeitsexzeß einiger
Haufen.
-Modell häufig höher bestimmte zentrale Dichte,
entsprechend dem zentralen Flächenhelligkeitsexzeß einiger
Haufen.
- Gasmassen der 53 Galaxienhaufen aus Tab. ,
bestimmt mit dem einfachen
 -Modell (Abszisse) und dem
Doppel-
-Modell (Abszisse) und dem
Doppel-  -Modell (Ordinate). Man erkennt, daß die Unterschiede
der beiden Methoden klein sind.
-Modell (Ordinate). Man erkennt, daß die Unterschiede
der beiden Methoden klein sind.
- Fehlerellipsen der Fitparameter
 und
und  für
den Galaxienhaufen Abell 2063. Die
Konturlinien liegen bei
für
den Galaxienhaufen Abell 2063. Die
Konturlinien liegen bei  ,
, 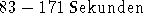 ,
,  und
und  Konfidenz. Bei den sechs Punkten auf der
Konfidenz. Bei den sechs Punkten auf der 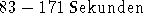 -Linie liegen die
Wertepaare, die für eine Gasmassenbestimmung benutzt wurden
(Tab. ).
-Linie liegen die
Wertepaare, die für eine Gasmassenbestimmung benutzt wurden
(Tab. ).
- Kumulative Verteilungsfunktion der gemessenen
Röntgenflüsse im Energiebereich
 der 61 Haufen
der Stichprobe. Die gestrichelte Linie
hat die Steigung -1.5, die man für gleichmäßig verteilte Haufen in
einem euklidischen Raum erwartet.
der 61 Haufen
der Stichprobe. Die gestrichelte Linie
hat die Steigung -1.5, die man für gleichmäßig verteilte Haufen in
einem euklidischen Raum erwartet.
- Differentielle Verteilung der Rotverschiebungen der
Stichprobe. Der Haufen am entfernten Ende ist Abell 2204 mit
z=0.1523.
- Die Leuchtkräfte im Energiebereich
 der
61 Haufen aufgetragen über der
Rotverschiebung. Man sieht auch, daß Abell 2204 zugleich der Haufen mit der
größten Leuchtkraft ist.
der
61 Haufen aufgetragen über der
Rotverschiebung. Man sieht auch, daß Abell 2204 zugleich der Haufen mit der
größten Leuchtkraft ist.
- Die Leuchtkraft in Abhängigkeit der Gastemperatur für 55
Galaxienhaufen. Ausgenommen sind alle Haufen, deren Temperatur mit der
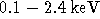 Relation bestimmt wurde, die Haufen Abell 3574 und
Abell 3628 (Daten für diese Haufen werden in keinem Diagramm
gezeigt, vgl. Tab. ), sowie alle Haufen mit
Relation bestimmt wurde, die Haufen Abell 3574 und
Abell 3628 (Daten für diese Haufen werden in keinem Diagramm
gezeigt, vgl. Tab. ), sowie alle Haufen mit  . Die durchgezogene Linie stellt die beste
Regressionsgerade an die Datenpunkte dar. Die gestrichelte Linie ist
die
. Die durchgezogene Linie stellt die beste
Regressionsgerade an die Datenpunkte dar. Die gestrichelte Linie ist
die 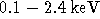 Relation von (Ma).
Relation von (Ma).
- Die Leuchtkraft in Abhängigkeit der Gastemperatur für 74
Galaxienhaufen. Ausgenommen sind alle Haufen, deren Temperatur mit der
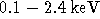 Relation bestimmt wurde. Bedeutung der Linien wie in
Abb. . Man erkennt, daß die Steigung zum
leuchtschwachen Ende hin steiler wird.
Relation bestimmt wurde. Bedeutung der Linien wie in
Abb. . Man erkennt, daß die Steigung zum
leuchtschwachen Ende hin steiler wird.
- Die Leuchtkraft in Abhängigkeit der Gasmasse für 88
Galaxienhaufen.
- Zentrale Elektronenzahldichte in Abhängigkeit der Gasmasse
für 88 Galaxienhaufen. Man erkennt, daß die zentrale
Elektronenzahldichte unabhängig von der Gasmasse ist. Die Benutzung
von zentralen Dichten, die mit dem Doppel-
 -Modell bestimmt
wurden, ändert an dieser Aussage nichts. Die Streuung zwischen
-Modell bestimmt
wurden, ändert an dieser Aussage nichts. Die Streuung zwischen
 Elektronen pro
Elektronen pro 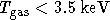 ist durch die
unterschiedlichen zentralen Flächenhelligkeiten bedingt, die
als Dichteschwankungen infolge unterschiedlich starker Cooling Flows
interpretiert werden können.
ist durch die
unterschiedlichen zentralen Flächenhelligkeiten bedingt, die
als Dichteschwankungen infolge unterschiedlich starker Cooling Flows
interpretiert werden können.
- Der Kernradius in Abhängigkeit der Gesamtmasse für 88
Galaxienhaufen. Die Streuung spiegelt die
Streuung in der zentralen Dichte wieder. Man beachte jedoch auch die
in Abschnitt abgeschätzten, nicht eingezeichneten, Fehler für die
Gesamtmassenbestimmung von
 bis zu einem Faktor zwei.
bis zu einem Faktor zwei.
- Die Leuchtkraft in Abhängigkeit der Gesamtmasse für 88
Galaxienhaufen.
- Die Gastemperatur in Abhängigkeit der Gesamtmasse für 74
Galaxienhaufen. Galaxienhaufen, deren Gastemperatur mit der
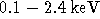 Relation bestimmt wurden, wurden ausgeschlossen.
Relation bestimmt wurden, wurden ausgeschlossen.
- Die Gastemperatur in Abhängigkeit der Gasmasse für 74
Galaxienhaufen. Galaxienhaufen, deren Gastemperatur mit der
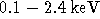 Relation bestimmt wurden, wurden ausgeschlossen.
Relation bestimmt wurden, wurden ausgeschlossen.
- Das Verhältnis von Gasmasse zu Gesamtmasse in
Abhängigkeit der Gasmasse für 88 Galaxienhaufen.
- Differentielle Leuchtkraftfunktion für 61 Galaxienhaufen. In jedem Bin
sind zehn inverse Suchvolumina aufaddiert und die Summe durch das
Leuchtkraftintervall geteilt. Das Leuchtkraftintervall ist gegeben
durch den Leuchtkraftabstand zwischen
dem leuchtschwächsten und leuchtkräftigsten Haufen im Bin plus dem
jeweiligen halben Abstand zu den angrenzenden Haufen. Dies bedingt,
daß der absolut leuchtkräftigste und leuchtschwächste Haufen
nicht in den 6 Bins enthalten sind, da sie benötigt werden, um das
Leuchtkraftintervall des ersten und letzten Bins zu berechnen.
Die jeweiligen Intervalle sind durch horizontale Balken
gekennzeichnet. Durch die vertikalen Balken sind die
Poissonfehler gegeben. Im Bin mit den leuchtkräftigsten Haufen sind
neun Haufen enthalten. Der beste Fit einer Schechter-Funktion
an die Leuchtkraftfunktion von [EBELING et al. 1997] ist durch die
gestrichelte Linie dargestellt.
- Integrale Gasmassenfunktion für 61 Galaxienhaufen. Auf der
Ordinate ist die Anzahldichte von Galaxienhaufen, deren Gasmasse
größer ist als die auf der Abszisse, aufgetragen. Im Bin mit den
Haufen mit den höchsten
Gasmassen sind elf Haufen enthalten, in den anderen Bins jeweils
zehn. Durch die vertikalen Balken sind die
Poissonfehler gegeben. Der horizontale Balken gibt die Differenz
zwischen dem Haufen mit der kleinsten und größten Gasmasse im Bin
an.
- Integrale Gesamtmassenfunktion für 61 Galaxienhaufen,
analog zur Gasmassenfunktion.
Thomas Reiprich
Sun Feb 14 18:22:39 MET 1999
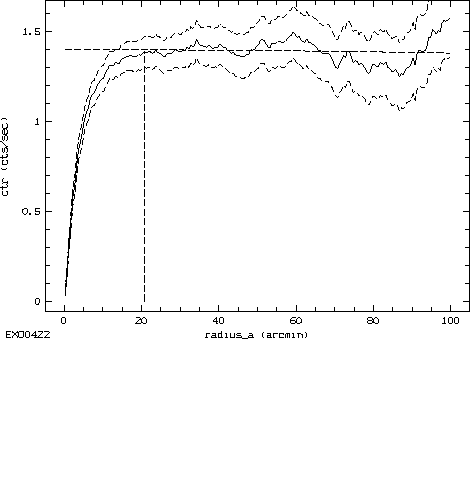 ) scheint die
Ursache eine Kombination von variierendem
Hintergrund und einigen diskreten Quellen in nicht verworfenen
Segmentflächen zu sein.
) scheint die
Ursache eine Kombination von variierendem
Hintergrund und einigen diskreten Quellen in nicht verworfenen
Segmentflächen zu sein.
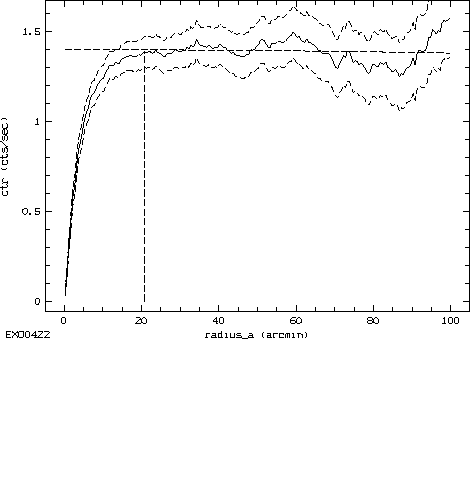 ) scheint die
Ursache eine Kombination von variierendem
Hintergrund und einigen diskreten Quellen in nicht verworfenen
Segmentflächen zu sein.
) scheint die
Ursache eine Kombination von variierendem
Hintergrund und einigen diskreten Quellen in nicht verworfenen
Segmentflächen zu sein.